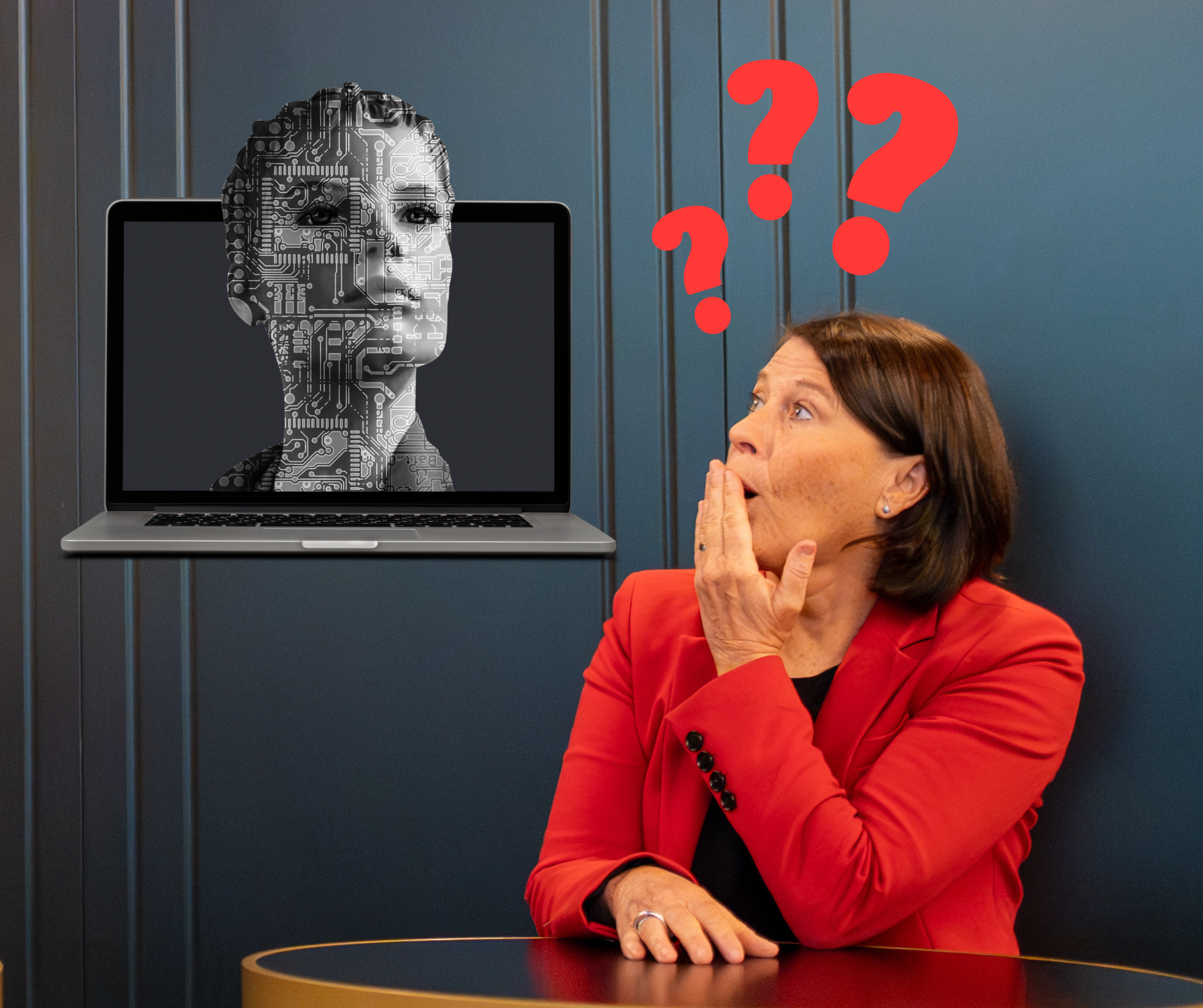Ein Freund von mir hat sich vor kurzem von seiner Frau getrennt. In seinem Schmerz kam er mir vor wie ein »Ertrinkender«, der sich mit aller Macht an eine Beziehung klammerte, die schon lange keine mehr war. Er selbst hatte mehr als einmal erzählt, wie sie seit Jahren nebeneinander her lebten. Warum also war er so neben der Spur und hielt krampfhaft an dieser Beziehung fest?
Mir fielen Szenen aus seinen vorangegangenen Partnerschaften ein, die früher oder später alle in die Brüche gegangen waren – übrigens nach einem sehr ähnlichen Verlauf. Ebenso erinnere ich mich an seinen Satz: »Ich spüre Liebe nur, wenn sie schmerzt.« Mit anderen Worten, wenn das Beziehungsende droht. Er meinte, er fühle sich erst im und mit dem Drama »lebendig« – wenn auch auf eine negative Art und Weise. Dann weiche seiner unerträgliche innere Leere Gefühlen der Angst, Wut und Verzweiflung.
Während ich erlebe, wie dieser sonst so kontrollierte Mann den Boden unten den Füßen verliert, frage ich mich einmal mehr, ob es sich wirklich um Liebeskummer handelt? Ist es nicht eher die Angst vor dem Verlust, die den seelischen Notstand bei ihm auslöst? Die Intensität der Gefühle zeigt nämlich nicht zwangsläufig immer die Stärke der Liebe, sondern auch den Grad der Abhängigkeit von der Zuwendung anderer Menschen. Diese Abhängigkeit begründet sich aus der Angst, allein zurückgelassen zu werden und zu sterben. Dabei ist diese Angst genauso wenig realistisch wie die Liebe real ist, die man in diesem Moment zu spüren glaubt. Denn natürlich sterben wir nicht, wenn Menschen sich von uns abwenden. Anders als zu dem Zeitpunkt, an dem diese existenziell bedrohliche Angst in den meisten Fällen entsteht.
In den ersten Lebensmonaten entwickeln Kinder durch die körperliche und emotionale Zuwendung von Mutter und Vater eine sichere Bindung. Kümmern sich die Eltern hingegen nicht gut um ihr Kind, kann dies in dem kleinen Wesen Ängste hervorrufen. Denn in seinem noch nicht vollständig entwickelten Gehirn kennt es nur zwei Modi: Existenz oder Vernichtung. Die psychologischen und bindungstheoretischen Auswirkungen auf das Erwachsenenleben sind oftmals fatal. Den Betroffenen fehlt es an (Ur-)Vertrauen – in Menschen, in Beziehungen und in die eigenen Fähigkeiten. Sie fühlen sich entweder nicht liebenswert oder als Versager oder beides. Entsprechend unsicher laufen sie durchs Leben und jede Form der Zurückweisung fühlt sich für sie existenziell bedrohlich an.
Nicht selten kommt es zu sogenannten Reinszenierungen, bei denen das frühkindliches Trauma in den Partnerbeziehungen gewissermaßen „nachgespielt“ wird. Wurde beispielsweise jemand als Kind von seiner Mutter allein gelassen und verlässt ihn dann der Partner, verursacht dieser im Jetzt erlebte Zustand einen Stress, wie er ihn in der damaligen Situation erlebt hat. Das Gefühl ist immer noch tief im Körper verankert. Der Stress wird somit reaktiviert und die manifestierte Angst angetriggert. Ohne sich dessen bewusst zu sein, sind alle Anstrengungen, die Beziehung aufrecht zu erhalten, nichts anderes als der verzweifelte Versuch zu überleben.
So wie bei meinem Bekannten, der bei jeder Trennung immer wieder dieselben Höllenqualen durchlitt. Er hat sich inzwischen professionelle Unterstützung gesucht. Ich wünsche ihm aus vollem Herzen, dass er sich von seiner tief sitzenden Angst vor Bindung und Verlust befreien kann.
Autorin: Elke Antwerpen